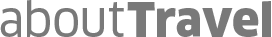Zum Interview empfängt Martin Nydegger – seit Januar Schweiz-Tourismus-Chef – im holzgetäfelten Büro seines Vorgängers in der Zürcher Tödistrasse. Die Plakate an der Wand sind nahezu noch dieselben. Das liegt einerseits wohl daran, dass der ST-Hauptsitz 2019 ohnehin in die alte Stadthalle zügelt. Aber es ist auch bezeichnend für Nydeggers Einstellung: Er will die Arbeit seines Vorgängers nicht umkrempeln und alles neu aufgleisen. Vielmehr will der bodenständige neue Chef fort- und weiterführen, was Jürg Schmid in 18 Jahren aufgebaut hat. Herausforderungen gibt es aber trotzdem genug.
Neu sind Sie ja nicht bei Schweiz Tourismus, Herr Nydegger. Aber seit Januar sind Sie der Chef und sozusagen für alles zuständig. Welche Prioritäten haben Sie in den ersten Monaten gesetzt?
Mein Mantra war, ganz viele Leute zu treffen und ganz viel zuzuhören. Ich befinde mich immer noch im Spongebob-Modus, fortlaufend am Aufsaugen. Ich treffe die wichtigsten Partner, extern aber auch intern. Im ersten Jahr will ich 15 bis 20 unserer Auslandsmärkte besuchen, derzeit bin ich bei sieben.
Sie machen also eine Art Bestandsaufnahme?
Als Interner besteht etwas die Gefahr, dass man annimmt, man kenne das ja alles schon. Und natürlich kenne ich Schweiz Tourismus. Aber gerade deshalb lohnt es sich besonders, genau zuzuhören. Natürlich wurden dabei auch schon Begehrlichkeiten und Wünsche an mich herangetragen, die ich gar nicht alle erfüllen kann. Einer möchte dies, der andere das Gegenteil davon. Aber so gewinne ich einen guten Überblick.
Ist es als Schweiz-Tourismus-Chef eigentlich ähnlich wie beim Fussball-Nati-Trainer? Acht Millionen Schweizer wissen besser wie’s geht?
Naja, das Themenfeld Tourismus ist vermutlich ähnlich emotional und universell wie der Fussball. Das heisst, jeder, der Ferien macht, kann mitreden. Zudem sind wir eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. Wir sind also in vielen Köpfen öffentliches Gut. Die Sache ist aber die: Ich kann nicht immer zwischen gut und schlecht entscheiden, manchmal ist es ein Entscheid zwischen gut und gut oder zwischen schlecht und schlecht.
Was sind Ihre ersten Erkenntnisse nach der Bestandsaufnahme? Gab es Überraschungen?
Direkte Überraschungen weniger. Das ist ein bisschen der Nachteil als Interner, der Aha-Effekt ist ausgeblieben, was aber nicht verkehrt ist. Allerdings bin ich beeindruckt, wie fit unsere Branche ist. Da haben schon sehr viele ihre Hausaufgaben gemacht. In den letzten acht Jahren, in denen wir wegen des Euro unten durch mussten, haben die Touristiker kooperiert, investiert, innoviert, an Kosten und Preisen gearbeitet. Wir sind signifikant kompetitiver als noch vor ein paar Jahren. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Und es ist schön zu sehen, dass wir bei Schweiz Tourismus die richtigen Leute an den richtigen Stellen haben. Das ist auch ein Kompliment an meinen Vorgänger.
Der hat sich oft über das Gärtlidenken beklagt und mehr Kooperation gefordert.
Kooperationen gibt es nicht auf Knopfdruck. Das ist bedauerlicherweise ein recht träger Prozess. Trotzdem gibt es sehr erfreuliche Kooperationsbemühungen, etwa bei den Bergbahnen. In der Romandie haben 25 Bergbahnen zusammen den Magic Pass herausgegeben. Im Berner Oberland gibt es neu den Top4-Skipass. Das sind Geschichten, die hätte man sich vor ein paar Jahren kaum vorstellen können, und heute sind sie Realität.
Sie waren seit 2008 für die Unternehmensentwicklung bei Schweiz Tourismus zuständig. Was stand damals im Fokus, was heute?
Ich habe den Bereich Business Development damals neu aufgebaut. Neben einem kreativen Teil brauchten wir auch einen strukturellen Verantwortlichen. Einen, der fünf bis zehn Jahre vorausschaut und touristische Phänomene beobachtet. Was kommt auf uns zu? Wir helfen dem Schweizer Tourismus, sich darauf vorzubereiten und die Ressourcen bestmöglich einzusetzen. Wir haben darum viele Studien gemacht und uns um Zukunftsthemen gekümmert.
Können Sie Beispiele für Ergebnisse nennen?
Eines davon ist die Grand Tour of Switzerland.
Da waren Sie ja sozusagen der Gründungsvater. Ist es erfolgreich?
Es ist erfolgreich und hat noch viel Potenzial. Wir wollten die Schweiz als Touringland auf die Weltkarte bringen. Touring ist eine Reiseform, die stark wächst. Bei der Informationsflut heute sind solche Routen eine Orientierungshilfe. Wir garantieren, dass man an den tollsten Orten vorbeikommt, man muss sie nicht selber suchen.
Hat die Tour im MICE-Bereich eine Bedeutung?
Überraschenderweise ja, neben den Individualgästen gibt es im Incentive-Bereich ganz viel Nachfrage. Dort haben wir ein Best-Practice-Beispiel. Der Reifenhersteller Michelin ist achtmal mit Top-Sales-Leuten in die Schweiz gekommen, um die Tour mit unglaublichen Autos zu fahren.
Alle Welt spricht derzeit ja aber vom Overtourism. Wie sorgt ST für die richtige Balance?
Die Frage beschäftigt uns stark. Ich bin überzeugt, dass wir nicht von einem flächendeckenden Overtourism gefährdet sind. Aber einzelne Engpässe wird es immer geben. Dann heisst das Stichwort «Crowd Management». Das tun wir nicht erst vor Ort, sondern schon draussen in den Märkten. Schweizer und Europäer reisen in der Schweiz überall hin. Darum spielen sie eine wichtige Rolle zur Vermeidung von Overtourism. Wir arbeiten deshalb mit Segmenten und sprechen statt dem generellen Sommergast z.B. den Outdoor-Enthusiasten an. Dieses Jahr u.a. mit dem Fokus auf das Veloland Schweiz.
Aber auch die Fernmärkte sind sehr wichtig.
Wenn wir diese in den vergangenen Jahren nicht gehabt hätten, hätte es nicht gut für uns ausgesehen. Wir brauchen die chinesischen, arabischen und indischen Gäste. Nur: Je weiter weg, desto mehr folgen die Gäste den Highlights mit internationaler Ausstrahlung. Deshalb fördern wir dort nicht unbedingt den Gruppen-, sondern den Qualitäts- und Individualtourismus. Das ist schwieriger und teurer. Aber diese Gäste sind für die weniger bekannten, genau zu den Segmenten passenden Destinationen zu begeistern, was den Mitteleinsatz effizienter macht.
Zudem gibt es immer mehr Kommunikationskanäle, welche die Kosten nach oben treiben.
Ja, diese Diversifizierung ist ganz klar ein Kostentreiber. Oft kann man den Content auch nicht in allen Märkten gleich nutzen.
Brauchen Sie dann mehr Geld?
Das Budget des Gesamtunternehmens liegt bei 95 Millionen Franken pro Jahr. Rund die Hälfte fliesst in digitale Kanäle. Wenn wir vorne etwas Neues machen, müssen wir hinten etwas abschneiden. Was ja nicht schlecht sein muss.
Wollen Sie in der Marketing-Ansprache der Europäer derzeit generell etwas ändern?
Im Marketing wollen wir emotionaler und sinnlicher werden. Fakt ist nämlich, dass im Freizeittourismus sehr oft die Frau auswählt. Deswegen wird es aber keinen speziellen «female hiking trail» geben. Denn die Frauen schaffen die gleichen Velostrecken wie die Männer. Aber sie wollen anders angesprochen werden.
Für das Jahr 2017 konnten Sie – als eine Ihrer ersten Amtshandlungen – einen Turnaround der Logiernächte aus Europa verkünden. Wie gut war das 2017 wirklich?
Nun ja, wir hatten ein Plus von 5,2 Prozent und 37,4 Millionen Logiernächte in unseren Hotels. Von daher könnte man denken, jetzt sei alles gut. Aber nach dem langen Rückgang seit 2008 haben wir das erste Mal wieder ein Plus aus den europäischen Märkten verzeichnet und sind noch längst nicht auf dem Stand von damals. Es ist ein langer Weg der Rückgewinnung der Europäer. Zudem bleiben die Berggebiete – trotz Zugewinnen – unsere Sorgenkinder, leider.
Aber den Städten geht es seit Jahren hervorragend. Warum boomen die Citys so?
Citytrips sind im Trend, und wem Barcelona zu voll ist, der kommt vielleicht nach Bern oder Zürich. Zudem sind viele zusätzliche Betten in den Städten entstanden, und es herrscht eine grosse Renovationsbereitschaft bei den Hotels. Eine interessante Entwicklung ist, dass die asiatischen Gäste in den Städten schlafen und dann für Ausflüge in die Berge fahren. Zudem haben die Städte dank der starken Konjunktur wieder kräftig an Businessgästen gewonnen.
Bleibt der Positivtrend 2018?
Die Grundlagen sind positiv. Die wirtschaftliche Situation in Europa und in der Schweiz ist gut. Zudem ist der Euro wieder etwas stärker. Wir erwarten 2018 darum ein Plus von drei bis vier Prozent bei den Logiernächten.
Der Geschäftsreisetourismus, zu dem auch das MICE-Segment zählt, machte 2017 in den Städten 67% aus, in den Bergen 20%. Ein Verhältnis, das Sie so akzeptabel finden?
Die Unterscheidung zwischen Stadt und Berg wird gar nicht mehr so gemacht. Genf oder Zürich werden im Ausland als Alpenstädte wahrgenommen. Das ist eine Riesenchance für uns, es schlägt quasi die Stunde des Sitzungszimmers auf dem Berg.

Wie hat sich der Meetingmarkt 2017 entwickelt? Im letzten Meetingreport stand für 2015 ein dickes Minus von 18% gegenüber 2011.
Eine exakte Zahl für den Gesamtmarkt in der Schweiz gibt es für 2017 nicht, die Zahlen werden nicht jährlich erhoben. Externe Indikatoren wie die Stabilisierung der Währungssituation im Euro-Raum sowie die zunehmende Nachfrage aus Asien legen den Schluss nahe, dass sich auch im Meetingtourismus eine Trendwende abzeichnet. Aufschlussreich ist dabei der Blick auf die Meetings, die von Schweiz Tourismus direkt akquiriert wurden: 2017 waren es fast 800 Kongresse mit einem Umsatz von 89 Millionen Franken. 2011 waren es noch 667 Kongresse mit einem Umsatz von 79 Millionen.
Ein grosses Thema in Schweizer Städten sind die Kongresskapazitäten. Inwieweit mischt Schweiz Tourismus sich in diese Debatte ein?
Wir sind dafür da, die Nachfrage zu fördern, auf politische Entscheide nehmen wir keinen Einfluss. Etwas anderes ist es, wenn in manchen Kongresscentern noch der Sixties- oder Eighties- Groove drin ist, dann mischen wir uns ein und sagen, es würde guttun, etwas zu erneuern. Dabei ist heute auch die Atmosphäre wichtig. Technisches Aufrüsten allein genügt nicht.
Wie bedeutend ist das Thema Hochpreisland Schweiz im Meeting-Bereich?
Hier ist Compliance ein grosses Thema. Darunter leidet v.a. die Fünf-Sterne-Hotellerie. Es gibt in den Bergen viele Fünf-Sterne-Hotels, die preislich konkurrenzfähig sind mit Vier-Sterne-Hotels in den Städten. Aber die Firmen machen es an den Sternen fest. Einige Häuser vermeiden es darum, sich auf fünf Sterne upgraden zu lassen.
Sind Sie eigentlich persönlich eher in Luxushotels oder auf dem Campingplatz anzutreffen?
Beides. Ich nächtige gerne in schönen Hotels. Vor zwei Jahren habe ich einen Sabbatical begezogen und war mit der Familie im Motorhome unterwegs. Und dann bin ich alleine noch den Jakobsweg gewandert und schlief dabei in schlichten Pilgerunterkünften.
Apropos Selbstfindung: Hat Ihr neues Amt Sie eigentlich als Person verändert?
Ich hoffe nicht. Mein Vorgänger hatte nach 18 Jahren eine starke Popularität. Ich bin jetzt einige Monate in dieser Position, weshalb ich diesbezüglich noch keinen Wandel wahrnehme. Die Leute erkennen mich nicht auf der Strasse, und das ist gut so. Was sich geändert hat, ist der Arbeitsumfang. Die Agenda ist schlichtweg explodiert. Das hätte ich ahnen können, aber die Realität hat mich doch ein bisschen schockiert.
Schockiert?
Naja, ich möchte eben auch einen intensiven Austausch mit allen pflegen. Das generiert viele Termine. Zudem gibt es viele Begehrlichkeiten, aber das ist ja schön. Es gäbe für eine Organisation wie Schweiz Tourismus nichts Schlimmeres, als irrelevant zu sein. Ich beklage mich darum nicht. Es ist intensiv, aber es macht viel Freude. Und das Produkt ist ja einfach der Wahnsinn.
Martin Nydegger, der «eher pragmatische Typ»
Martin Nydegger (47) ist seit Januar 2018 Direktor von Schweiz Tourismus (ST). Als Bauernsohn aus dem bernischen Büren absolvierte er eine Lehre als Landmaschinenmechaniker und schulte dann auf Tourismus um. Er ist Tourismusfachmann und hält einen Executive MBA der University Strathclyde Glasgow. 1999 bis 2005 amtete Nydegger als Tourismusdirektor in Scuol, dann vertrat er das Reiseland Schweiz in den Niederlanden. 2008 kam er in die ST-Zentrale nach Zürich – als GL-Mitglied im Ressort Unternehmensentwicklung. Sich selbst beschreibt er als «eher pragmatischen Typ», der sich nach 18 Jahren Jürg Schmid weder von seinem Ex-Vorgesetzten distanzieren noch ihm nacheifern, sondern seinen eigenen Weg gehen will. Dass die Wahl für den ST-Chefposten auf einen Internen fiel, hatte damals viele überrascht.